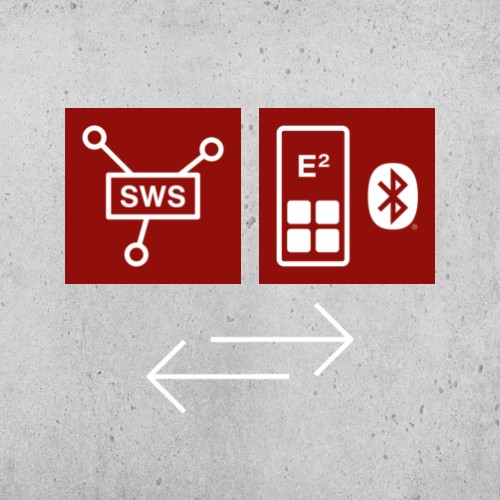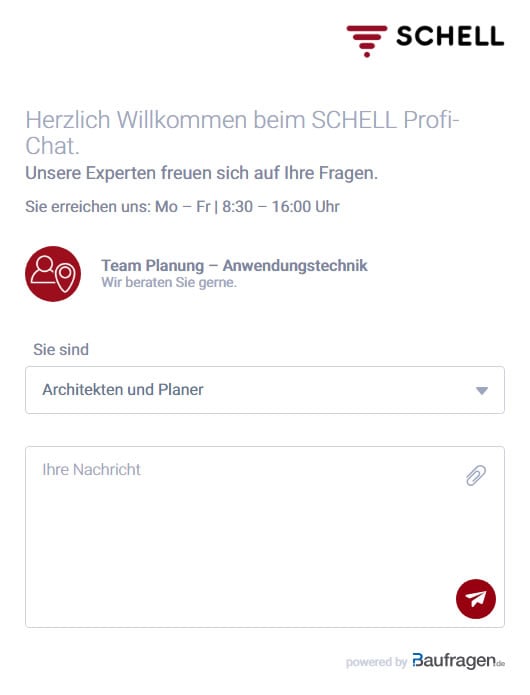Vorsicht bei Kaltwasserleitungen: Legionellen und Pseudomonas aeruginosa vermeiden
Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel – und dennoch birgt es Risiken, wenn Trinkwasserinstallationen nicht fachgerecht geplant, installiert und betrieben werden. Um die Trinkwassergüte zu erhalten und eine übermäßige Vermehrung von gesundheitsgefährdenden Bakterien wie Legionellen oder Pseudomonas aeruginosa zu verhindern, sind zwei Aspekte essenziell: ein regelmäßiger Wasserwechsel mindestens alle 72 Stunden und die Einhaltung von Temperaturgrenzen für Trinkwasser warm (PWH) und Trinkwasser kalt (PWC). Denn gerade zu hohe Kaltwassertemperaturen sind in den letzten Jahren vermehrt ursächlich für hygienische Risiken im Trinkwasser von Gebäuden. Mit gezielten baulichen und betriebstechnischen Maßnahmen können Planer und Betreiber einer unzulässigen Kaltwassererwärmung und teuren Sanierungen jedoch gezielt vorbeugen.
Legionellen und Pseudomonas aeruginosa: Was ist das eigentlich?
Legionella spec. und Pseudomonas aeruginosa sind stäbchenförmige Bakterien, die in extrem geringen Konzentrationen natürlicherweise im Trinkwasser enthalten sein können, in hohen Konzentrationen jedoch zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen können. Gerade vulnerable und vorerkrankte Personen sind gefährdet, weshalb diese Bakterien im Gesundheitssektor auch als wesentliche Leitbakterien für eine einwandfreie Trinkwasserhygiene gelten.
Legionellen und Pseudomonas aeruginosa im direkten Vergleich
Die folgenden Tabellen geben einen vergleichenden Überblick über die wichtigsten Eigenschaften von Pseudomonas aeruginosa und Legionella spec.:
Ursachen einer Kontaminierung von Kaltwasserleitungen
Seit etwa zehn Jahren kommt es in Kaltwasserleitungen häufiger zu Legionellenproblemen als in Warmwasserleitungen. Zwei wesentliche Gründe dafür sind die immer dichteren Gebäudehüllen und sogenannte „Luxusinstallationen“ mit immer mehr und komplexer verlegten Rohrleitungen und „Wärmetauscherinstallationen“ mit eingeschleiftem Kaltwasser und gleichzeitig zirkulierendem Warmwasser in den Vorwänden.
Technische Schwachstellen der Trinkwasserinstallation
Für eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserqualität muss die Temperatur im Trinkwasser warm (PWH) mindestens 55 °C nach 3-Liter-Ablauf an jeder Entnahmestelle betragen und im Trinkwasser kalt (PWC) unter 25 °C, ebenfalls nach 3-Liter-Ablauf. Doch in der Praxis gibt es zahlreiche bauliche Faktoren, die zu einer unzulässigen Erwärmung des Kaltwassers und einer Kontaminierungsgefahr führen können:
- Moderne Bauweisen: Übergroße, hydraulisch kaum zu beherrschende Trinkwasserinstallationen mit übermäßig vielen Entnahmestellen. Sie können im Vergleich zu modernen T-Stück-Installationen bis zu 29 % größere Oberflächen aufweisen, die vermeidbar mehr Wärme aufnehmen (PWC) und diese Wärme in einem um bis zu 25 % überhöhtem Wasservolumen speichern. Hygienische Risiken sind die Folge.
- Fehlende thermische Trennung von Warm- und Kaltwasserleitungen (z. B. gemeinsame Steigschächte mit warm- und kaltgehenden Leitungen, überhöhte Temperaturen in Technikzentralen) führt zu unerwünschtem Wärmeeintrag in das Kaltwasser.
- Komplexe Trinkwasserinstallationen mit hygienisch riskanten und vermeidbaren Zirkulationsleitungen in den Vorwänden, obwohl es eine 3-Liter-Regel für Einzelzuleitungen gibt. Überhöhte Temperaturen im Kaltwasser und verstärkte Zirkulationswärmeverluste sind die Folge.
- Kontaminierte Bauteile (z. B. durch Dichtheitsprüfung mit Wasser im Werk) können die Trinkwasserinstallation bereits vor Inbetriebnahme mit Mikroorganismen belasten, insbesondere mit Pseudomonas aeruginosa.
Einflüsse von Betrieb und Nutzung
Neben baulichen Aspekten spielt vor allem der bestimmungsgemäße Betrieb und in diesem Zusammenhang vor allem die regelmäßige Nutzung aller Entnahmestellen eine entscheidende Rolle für den Erhalt der Trinkwassergüte in Gebäuden. D. h. Trinkwasserinstallationen müssen regelmäßig, aber spätestens nach 72 Std., über alle Entnahmestellen genutzt werden. Dabei sind die bei Planung und Errichtung zugrunde gelegten Betriebsbedingungen und sicheren Temperaturbereiche im Warm- und Kaltwasser einzuhalten. Jede nicht regelmäßig genutzte Entnahmestelle wird zu einer Totleitung voller Leben, unabhängig von der Art der Rohrleitungsführung. Zudem sind regelmäßige Kontrollen aller Bauteile auf Funktion und erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für den betriebssicheren Zustand aller Bauteile durchzuführen. Auch diese Aufgaben gehören zum bestimmungsgemäßen Betrieb, der keinesfalls nur auf den regelmäßigen und vollständigen Wasserwechsel reduziert werden darf!
Pflichten des Betreibers
Damit ein bestimmungsgemäßer Betrieb gewährleistet und eine übermäßige Bakterienvermehrung verhindert wird, muss das Wasser regelmäßig – spätestens aber alle 72 Stunden – vollständig und über sämtliche Entnahmestellen ausgetauscht werden. Hierzu sind Betreiber von Trinkwasserinstallationen über § 13 TrinkwV verpflichtet. Zudem sind im Betrieb mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Diese Regeln fodern gemäß DVGW und VDI einen regelmäßigen und vollständigen Wasserwechsel über alle Entnahmestellen. Nur dieser erhält die Wassergüte in Gebäuden! Dafür gibt es keinen Ersatz durch eine besondere Art der Rohrleitungsführung oder einen Wasserwechsel allein über endständige Spülstationen. Letztere können allenfalls unterstützend sein.
Untersuchungspflicht auf Legionellen im Kaltwasser
Besteht der Verdacht, dass das Kaltwasser zu warm wird, ist auch dieses auf Legionellen zu untersuchen (DVGW W 551 (A)). Dies kann einfach überprüft werden: Überschreitet nach 3-Liter-Ablauf die Temperatur des Kaltwassers die bekannten 25 °C, gemessen in einem Volumen von 250 ml (VDI 6023 Blatt 1), hat sich dieser Verdacht erhärtet. Die „30-Sek.-Ablauf-Regel“ der DIN 1988-200 sollte aufgrund dieser aktuelleren und viel exakter festgelegten Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht mehr angewandt werden.
Aktive Maßnahmen: Trinkwasserhygiene während des Betriebs sichern
Selbst die durchdachteste, hygienesicherste Planung einer Trinkwasserinstallation nützt nichts, wenn im späteren Betrieb kein regelmäßiger und vollständiger Wasserwechsel über alle Entnahmstellen erfolgt. Tipp: Vermieter von gewerblichen Einrichtungen oder Wohngebäuden sollten ihre Mieter unbedingt auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Nutzung aller Entnahmestellen hinweisen und diesen Aspekt bereits im Mietvertrag verankern. Über die normale Nutzung hinaus sind folgende Maßnahmen notwendig, um den Erhalt der Trinkwassergüte optimal zu unterstützen:
- Regelmäßige Stagnationsspülungen bei Betriebsunterbrechungen von mehr als 72 Std.: entweder manuell umgesetzt mithilfe von händisch ausgeführten Spülplänen oder – weitaus effizienter – automatisiert mithilfe eines Wassermanagement-Systems wie SWS von SCHELL
- Überwachung der Temperaturen im Trinkwasser warm und kalt mithilfe von Temperatur-Fühlern: Mit SWS von SCHELL lassen sich Stagnationsspülungen zeit- und temperaturgesteuert auslösen. So wird sofort automatisch gegengesteuert, wenn Temperaturgrenzen über- bzw. unterschritten werden
- Regelmäßige Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen (Inspektion, Wartung, Verbesserungen etc.) gemäß Herstellerangaben und DIN EN 806-5
Weitere umfassende Empfehlungen und Details zu passiven sowie aktiven Maßnahmen zur Einhaltung der normativ und hygienisch geforderten Temperaturen für Trinkwasser kalt bietet der BTGA-Praxisleitfaden „Wie halte ich Kaltwasser kalt“.
Sichert Wassergüte und -temperaturen durch einen regelmäßigen und vollständigen Wasseraustausch: SCHELL SWS
Der Erhalt der Trinkwassergüte ist eine zentrale Verantwortung für Planer und Betreiber von Trinkwasserinstallationen. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Kaltwasserleitungen liegen, da das Risiko einer übermäßigen Vermehrung von Legionellen und vor allem Pseudomonas aeruginosa hier besonders hoch ist. Durch eine optimierte Planung und Auslegung der Trinkwasserinstallation (passive Maßnahmen) sowie einen hygienegerechten Betrieb (aktive Maßnahmen) kann einer übermäßigen Erwärmung des Trinkwassers kalt und einer Kontamination effektiv vorgebeugt werden. Wassermangement-Systeme wie SWS von SCHELL stellen im Betrieb eine hocheffiziente und sichere Lösung zur zeit- und temperaturgesteuerten Umsetzung von Stagnationsspülungen dar.